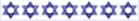Wer sind wir?
Forenregeln
Links/Tipps
Urheberrecht
Gästebuch
Wo ist die Liebe geblieben?
Was hat man mit der Liebe gemacht?
Wird Liebe leben überhaupt noch verstanden?
Die Liebe ist traurig, wurde weggeworfen - braucht man nicht mehr.
Die Liebe fragt, schreit nach:
Anstand, wo bist du?
Ehrlichkeit, wo bist du?
Achtsamkeit, wo bist du?
Höflichkeit, wo bist du?
Freundlichkeit, wo bist du?
Rücksichtnahme, wo bist du?
Gehorsam, wo bist du?
Vertrauen, wo bist du?
Helft der Liebe wieder ihren Urstand zu finden und lernen wieder Liebe zu leben!
Darf gerne geteilt werden...von JOELA So 20 Okt 2024, 19:00
» Hisbollah+HAMAS Vernichtung
von ABA Sa 19 Okt 2024, 16:00
» الخلافة ألمانيا KALIFAT-Germania
von ABA Mi 16 Okt 2024, 00:00
» יוֹם כִּפּוּר
von ABA So 13 Okt 2024, 11:00
» 7. Oktober 2023
von ABA Mo 07 Okt 2024, 00:00
» 5785
von ABA Sa 05 Okt 2024, 01:41
» NAHOST-Ticker
von ABA Fr 04 Okt 2024, 11:33
» Die Wahrheit über Palästina
von ABA Mi 25 Sep 2024, 16:00
» »NATURKATASTROPHEN« - “STRAFEN GOTTES” - und doch NICHTS daraus gelernt
von ABA Di 17 Sep 2024, 10:10
» UNRWA »Ein Hilfswerk für Terroristen«
von ABA Fr 13 Sep 2024, 16:30
Keine
Der Rekord liegt bei 575 Benutzern am Di 05 Dez 2023, 20:43
Tiere sehen dich an
 Tiere sehen dich an
Tiere sehen dich an
Tiere sehen dich an
Von Schreiber, MathiasDie Botschaft europäischer Denker und Dichter ist eindeutig: Wer Tiere misshandelt, verletzt die Menschenwürde.
Felsige Landschaft mit Mönchen. Plötzlich taucht ein Löwe auf. Er brüllt martialisch vor Schmerz. Die heiligen Männer ergreifen die Flucht.
Nur einer bleibt stehen: Hieronymus. Er lässt das hinkende Tier näher an sich heran. Und er sieht: In einer Tatze steckt ein Dorn. Hieronymus zieht ihn heraus, versorgt die Wunde und hat einen Freund fürs Leben gewonnen. Der Löwe wird zum Haustier und bewacht fortan nicht nur die Mönche, sondern auch den Esel, der für sie arbeitet.
Eine tiefsinnige Legende. Hieronymus war kein Natur-Simpel. Er war einer der klügsten Mönche der römischen Kirche. Er hat, im 4. Jahrhundert, als Erster die komplette Bibel ins Lateinische übersetzt. Er soll nicht weniger als sieben Sprachen beherrscht haben.
Und was er übertrug, nahm er ernst. Weil es im ersten Kapitel des Schöpfungsberichts heißt, Gott habe den Menschen und Tieren "alle grünen Pflanzen zur Nahrung" gegeben, wurde Hieronymus Vegetarier. Auch seinen Löwen, sagt die Legende, habe er vegetarisch gefüttert.
Die Maler der Jahrhunderte zeigen den lesenden oder schreibenden Gelehrten, der nacheinander Einsiedler, Papst-Berater und Begründer eines Klosters war, stets in Gesellschaft seines Löwen, gelegentlich auch anderer Tiere. Die Botschaft der Bild-Geschichte hat mit Idyllik wenig zu tun. Sie lautet: Die Natur, vor allem die der Tiere,
ist keine dumpfe Gegenwelt zur intellektuellen Zivilisation, sondern deren Begleiter und Ermöglicher; kein Feind des Literatensalons, sondern dessen heimlicher Verbündeter. Der Löwe hilft Hieronymus beim Übersetzen - indem er aufpasst, für Ruhe sorgt und durch sein bloßes Erscheinungsbild sprachliche Anmut nahe legt.
Die Begründung für diesen relativ hohen Rang des Tiers ist im frühen Christentum sehr einfach: Gott hat der Erschaffung der Tiere immerhin mehr als einen Schöpfungstag reserviert - mehr Zeit als der Kreation des Menschen; und "alle Arten" hat er liebevoll ins Leben gerufen, angeschaut und "gut" gefunden. Auch zum "ewigen Bund" zwischen Schöpfergott und Geschöpf gehört "alles lebendige Getier". "Herrschen" darf der Mensch über die ihm anvertraute Natur nur nach dem "Abbild" der göttlichen Regentschaft über die Menschen: anschauend, barmherzig, gerecht. "Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs", heißt es im Buch der Sprichwörter. Das Alte Testament bezieht das "Vieh" sogar ausdrücklich in die Sabbatruhe ein.
Demnach wird die Menschenwürde auch dadurch definiert, dass der Mensch für die Würde der ganzen Schöpfung mitverantwortlich ist. Das bedeutet: Die Missachtung der animalischen Geschöpfe ist nicht nur gottlos; sie mindert auch die Menschenwürde.
Im hohen Mittelalter, um 1200, steigert der Mönch Franz von Assisi diese Hochschätzung der tierischen Natur, indem er - darin Hieronymus ähnlich - wiederum eine Aussage der Bibel beim Wort nimmt. Evangelist Markus lässt Jesus zu seinen Jüngern sagen: "Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur" - also nicht bloß den Menschen. Der heilige Franz predigte denn auch allen Ernstes dem "Bruder Vogel" und dem "Bruder Wolf".
Noch der Theologe Karl Barth dachte in dieser Tradition, als er 1970 über die unsichtbaren Gründe der tierischen "Ehre" schrieb: "Ihre Ehre ist die Verborgenheit ihres Seins mit Gott nicht weniger, als unsere Ehre dessen Offenbarsein ist." Tiere sind, folgt daraus, keine Gegenstände, kein totes "Nicht-Ich", wie der idealistische Philosoph Fichte Ende des 18. Jahrhunderts jene Welt definierte, die dem Geist entgegensteht. Sie sind Lebewesen aus eigenem Recht und mit eigenen Geheimnissen, die es zu respektieren gilt.
Und nicht allein aus religiöser Überzeugung. Als erstes deutsches Land hat das Königreich Sachsen, nach englischem Vorbild, im Jahr 1838 die Tierquälerei unter Strafe gestellt. Artikel 310 des Kriminalgesetzbuchs sagt: "Boshaftes und mutwilliges Quälen von Tieren wird mit Gefängnis bis zu vier Wochen oder entsprechender Geldstrafe bestraft." Das heutige deutsche Tierschutzgesetz spricht von der "Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf", dessen "Leben und Wohlbefinden zu schützen" seien.
In dem Begriff "Mitgeschöpf" wirkt der christliche Glaube an den Schöpfergott immer noch nach. Im Übrigen ergibt sich die Begründung für das Quälverbot längst aus jenem kulturellen Minimalkonsens, den 2000 Jahre Christentum und nicht zuletzt das Humanitätsideal der Goethezeit etabliert haben. Danach ist das Lebensglück empfindsamer Menschen mit der Wahrnehmung offensichtlicher, mutwilliger Tierquälerei unvereinbar.
Die lebhaftesten Zeugen für die Gültigkeit dieses Standards sind die Poeten und Künstler. Sie feierten das Eigenrecht animalischer Schönheit, wie zum Trotz gegen den Utilitarismus ihrer Epoche, zu einer Zeit, die vom allmählichen Aufstieg der alles entzaubernden Industrialisierung geprägt ist.
Die anrührendsten Tierbilder stammen von lyrisch empfindenden Dichtern wie Lord Byron ("Inschrift auf dem Denkmal eines Neufundländer-Hundes"), Theodor Storm (in seinen Gedichten tummeln sich Laufkäfer, Störche, Möwen und Nachtigallen) oder Alexander Puschkin - seine Ballade "Das Lied vom weisen Oleg" ist die ergreifende Liebeserklärung an ein Pferd ("Ach, wenn mich mein Ross heut noch trüge!"). Nachgewirkt hat diese Tradition das ganze 20. Jahrhundert.
Unvergesslich ist Rainer Maria Rilkes Bild vom Hund, der "fast mit einem Flehen" sein Gesicht in die Menschenwelt hält - "und doch verzichtend, denn er wäre nicht". Und natürlich das berühmte "Panther"-Gedicht: "Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille / sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein / geht durch der Glieder angespannte Stille / und hört im Herzen auf zu sein."
Diese Schlussstrophe deutet an: Ein Tier wie der Panther ist nicht nur stattlich, es verfügt auch über eine verborgene Teilhabe am Weltganzen, und sei diese noch so flüchtig - also über eine Vorstufe zum Menschen-"Geist". Darum beklagt der Gedichtanfang das Eingesperrtsein des Panthers, der "hinter tausend Stäben keine Welt" mehr ahnen darf.
Wie ein Echo auf Rilkes "Vorhang der Pupille" mutet der Titel eines Groß-Essays von Hans Wollschläger an: "Tiere sehen dich an." Wollschläger ist Übersetzer wie der heilige Hieronymus. Der James-Joyce-Spezialist veröffentlichte 1987 eine Polemik gegen die (Tier-) "Zucht- und Schlachtanstalten der so genannten zivilisierten Nationen", die so heftig wie ak-tuell ist. Angesichts der "Gräuel" von Massentierhaltung, Massentiertötung und Tierversuchs-Unwesen vergehe, so Wollschläger, dem sensiblen Zeitgenossen allmählich die "Fähigkeit, seines Mitlebens froh zu werden". Sogar "eine Verbindung zwischen den Leiden der Tiere und den sich pandemisch verbreitenden psychischen Krankheiten ihrer menschlichen Mittiere, gar deren täglich unbändigerer Bösartigkeit" sei nicht so "absurd", wie sich der nüchterne Blick das einbilde.
Die Übertreibung enthält einen wahren Kern: Das harmonische Naturbild - etwa der Blick einer Kuh, dessen dunkle, runde Ruhe wie "das Auge der friedlichen Wiesen" (Hellmut von Cube) wirkt - hat die Menschen jahrhundertelang erfreut und nicht nur bei Liebeskummer getröstet. Wenn die agrarindustriellen Horrorszenen des massenhaften Züchtens, Mästens, Schlachtens und Verwertens, in eins mit der Zersiedelung der Landschaft, diesen Trost zerstören, wird auch die menschliche Psyche beschädigt.
Einem Hieronymus, dem kein Löwe mehr zuschaut, verdorrt die Phantasie. MATHIAS SCHREIBER
* Oben: Gemälde von Sano di Pietro (1444); unten: von Giotto (um 1300).
DER SPIEGEL 13/2001
Quelle: Der Spiegel
 Ähnliche Themen
Ähnliche Themen» Wie ist Jeschua wirklich zu sehen?
» Der Mensch das größte Ungeheuer!
» Glauben ist, mit dem Herzen wissen!
» uralte Worte in Felsboden in IsraEl eingraviert und per Satelitaufnahmen zu sehen




 von
von